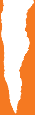programm
kalender
vermittlung
service
presse
about
partner
Die Suche ist auf der aktuellen Webseite verfügbar.
| "Brutalität ist schick" LITERATUR Am Wochenende wurde "junk space", das neue Stück von Kathrin Röggla, uraufgeführt. Ein Gespräch mit der österreichischen Autorin über Flugangstseminare, Theaterskepsis, Staats- und Nobelpreise und die Notwendigkeit von Verweigerung. |
Für das Theater schreibt Röggla erst seit kurzem. Ihr erstes Stück "fake reports" – uraufgeführt vor zwei Jahren im Forum U3 des Wiener Volkstheaters – war eine Bühnenadaption des Prosawerks "really ground zero", einer vielstimmigen Collage zum medialen Echo auf die Katastrophe des 11. September. In Düsseldorf hatte im vergangenen Frühjahr eine szenische Fassung des Romans "wir schlafen nicht" Premiere. Das neue Drama "junk space", das am Wochenende beim steirischen herbst uraufgeführt wurde, ist sozusagen Rögglas erstes Originalstück. Wie bei "fake reports" führte Tina Lanik Regie; die Inszenierung ist eine Co-Produktion mit dem Theater am Neumarkt in Zürich. Das Gespräch mit der Autorin fand kurz vor der Premiere in Graz statt. Falter: Was bedeutet eigentlich "junk space"? Kathrin Röggla: Das ist ein Begriff, den der Architekt Rem Koolhaas für Räume verwendet, die sehr schnell unterschiedliche Funktionen übernehmen können: zum Beispiel Foyers oder Atrien in Shoppingmalls. <br> Ihr Stück "junk space" liest sich ein bisschen wie ein Neben- oder Anschlussprojekt zu Ihrem Roman "wir schlafen nicht". Wie sehen Sie das? Es gibt ja schon eine Stückfassung des Romans. "junk space" ist eine Weiterentwicklung. Im Zuge der Gespräche, die ich für den Roman mit Unternehmensberatern, Coaches und Wirtschaftsjuristen geführt habe, habe ich immer wieder von Leuten mit Burnoutsyndrom gehört. Außerdem beschäftige ich mich schon seit längerem mit Angst. Ich habe bei einem Flugangstseminar die entsprechende Klientel getroffen, das kostet ja immerhin 750 Euro ... Sie haben Flugangst? Nein, das war Recherche. Ich habe nur eine Hundephobie, kenn das also insofern schon. Dem Fliegen kann man aber leichter aus dem Weg gehen als den Hunden. Vom Leiter einer Angstklinik kenne ich den zynischen Spruch: "Ein Straßenkehrer, der Flugangst hat, ist nicht krank – ein Manager mit Flugangst schon." Die These meines Stückes ist ja, dass es eine Kongruenz zwischen einer gewissen Leistungs- und einer Therapierhetorik gibt. Und um die Begriffe "Raum", "Angst" und "Leistung" geht es in "junk space". War das im Vorhinein klar? Nein, das habe ich erst später entdeckt. Angefangen hat es mit dem Flugangstseminar, dann habe ich mit Therapeuten gesprochen, viel dazu gelesen ... In diesen Gesprächen habe ich inhaltlich viel erfahren, aber im Unterschied zu "wir schlafen nicht" keine Rhetoriken, keinen Jargon der Angst gewonnen, mit dem ich direkt arbeiten hätte können – deswegen ist das Stück wirklich etwas ganz anderes. Man hat auch den Eindruck, dass es Ihr erstes Stück ist, das wirklich fürs Theater geschrieben wurde. Ja, ich weiß jetzt ungefähr, was ich vom Theater will, finde meine alten Stücke deswegen aber nicht schlechter. Inwiefern hat sich denn Ihre Einstellung zum Theater geändert? Sie hatten ihm gegenüber ursprünglich ja eine eher reservierte Haltung. Die habe ich nach wie vor. Mich interessiert auch nicht besonders, was für ein Diskurs da heute läuft. Was reizt Sie dann? Beispielsweise die Möglichkeit, mit anderen Menschen sechs Wochen an einem Text zu arbeiten. Das ist ein riesiger Luxus! Das Lektorat bei einem Roman dauert allerhöchstens eine Woche. Im Falle von "junk space" habe ich während des Schreibens, drei, vier Wochen vor der Abgabe viel mit der Regisseurin und dem Dramaturgen über den Text gesprochen, die dann auch ein Feedback geben und sagen: Das funktioniert nicht, mach das noch mal klarer ... Worum es konkret in diesem Seminar geht, an dem die Figuren von "junk space" teilnehmen, erfährt man eigentlich gar nicht. Das würde dem Ganzen schon wieder etwas wegnehmen. Mir ging’s mehr um dieses ständige Pochen auf Selbstverantwortung, Freiwilligkeit, Umprogrammierbarkeit. Es geht ja nicht mehr um das Subjekt, mit dem sich die Psychoanalyse befasst und dessen Störungen man aus seiner Biografie erklären muss, sondern nur noch darum, ein Symptom schnell auszulöschen und die entsprechende Person wieder zum Funktionieren zu bringen. Hat "junk space" etwas von einem Gleichnis, wenn es schon kein Stück über Flugangstseminare sein soll? Ich frage mich, ob es ein "Stück über ..." überhaupt gibt? Na, "Othello" ist schon ein Stück über Eifersucht. Nee. Wenn Sie in München mit Herrn Baumbauer (Frank Baumbauer, Intendant der Münchner Kammerspiele, Anm. d. Red.) darüber reden, wird der Ihnen genau das Gegenteil davon erzählen. Ich fand das sehr interessant, wie die das gemacht haben: eben nicht als Eifersuchtstück, sondern als ein Drama über Typen, die gelangweilt auf Zypern rumhängen und sich immer mehr in Intrigen verstricken. Ich komme mit diesem "Es geht um ..." schlecht zurecht. Theater ist ein Medium, es geht um Übersetzungen. Und mich interessieren vermischte Verhältnisse: Konkretion, Abstraktion, Theorie, Feldforschung, subjektive Wahrnehmung ... Mir wäre es zu langweilig, etwas abbilden zu wollen. Auf der Bühne interessiert mich auch weniger die Einzelfigur als das, was sich zwischen den Figuren abspielt. Was mich an der Theaterarbeit sehr erstaunt, ist der Umstand, dass Schauspieler anscheinend dazu neigen, hauptsächlich über ihre Figur nachzudenken und die zu spielen. Wenn ich Schauspieler wäre, würde mich das Miteinander viel mehr interessieren. Um einmal bei der Konkretion zu bleiben: Was passiert den eigentlich bei einem Flugangstseminar? Das ist meist ein Wochenende. Zuerst, am Samstagvormittag, erzählt jeder ein bisschen, was er eigentlich hat. Es gibt ja viele Leute, die gleich mehrere Störungen aufweisen und auch unter Agoraphobie leiden oder in keinen Lift einsteigen können. Am Nachmittag kommt dann der Pilot und erzählt, warum man gar nicht abstürzen kann. Und das hilft? Absolut. Das war das, was bei allen sehr angesprochen hat. Der Satz "Eine Boeing ist ein Segelflugzeug" hat mich auch sehr überzeugt. Wenn sie mal oben ist. Das ist der Punkt: Sie muss über tausend Meter gekommen sein, und dann fliegt sie pro tausend Meter "Absturz" 25 Kilometer weit. Es gibt einen durchgehenden Stahlträger, die Flügel können nicht abfallen – und überhaupt gab’s bei der Lufthansa seit dreißig Jahren keinen Absturz. Daneben gibt’s in dem Seminar halt noch Körpertraining: Man übt, wie man mit einer Panikattacke umgeht. Im Grunde genommen ist das alles Psycho light. Und am Schluss kommt dann die "Praxis" – ein Flug. Woher kommt Ihr großes Interesse an Phobien? Es lässt sich statistisch festmachen, dass Angststörungen zunehmen – die sind neben Depressionen und Alkoholismus die große psychische Erkrankung der Gegenwart, es ist hauptsächlich Angst, mit der Politik gemacht wird, was sich oftmals über ein bestimmtes Verhältnis zum Raum ausdrückt. Und das hat wieder mit diesen räumlichen Phobien zu tun. Sie versuchen also so etwas wie Gegenwartsanalyse. In Ihrem heuer erschienenen Roman "wir schlafen nicht" geht es um Leistungsdruck. Ja, aber mir schien es in der Folge von Dirk Kurbjuweits Buch "Unser effizientes Leben" oder auch meinem Roman etwas zu einfach, alle Schuld auf die Unternehmensberater abzuladen. Die haben reale Macht, keine Frage. Aber wenn ich mir eine Consultingfirma ansehe, interessiert es mich nicht, eine fremde Welt zu porträtieren, sondern ich will wissen, was von diesem Potenzial auch in mir vorhanden ist. Sie führen ja auch ein supereffizientes Leben. Ihre Recherchen werden für Romane und Stücke ausgewertet ... "junk space" ist schon noch was ganz anderes als der Roman. Hier hat mich das Thema des ewigen Lernens interessiert, dass man sich immer weiterbilden, sich letztlich ständig über den Haufen werfen und neu zusammenbauen muss. Warum haben die Consultingtypen, die Sie für Ihren Roman interviewt haben, überhaupt mit Ihnen gesprochen? Die sind doch der Auffassung: Zeit ist Geld. Das hat mich auch gewundert. Ich glaube aber, dass es für die sehr spannend ist, in einem strategiefreien Raum über ihre Arbeit zu reden. Wenn die nach Hause kommen, interessiert das ja keinen. Hatten die keine Angst, in die Pfanne gehauen zu werden? Ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte von denen war der eigenen Arbeit gegenüber sehr kritisch eingestellt, sie verfügen über eine Art zynisches Bewusstsein. Und die meisten machen das auch nur für eine bestimmte Zeit. Dann kommt das Burnout? Das kommt wirklich! Ich find das irre! Ich habe nach dem Roman aus Spaß im ICE Gespräche angefangen – da sitzen ja nur Unternehmensberater rum – und war weniger vorsichtig, weil ich eigentlich kein Material mehr brauchte; da kam die Rede sehr schnell auf das Burnout – das gehört richtig dazu: Absturz, soziale Isolation ... Wie lange dauert es bis zum Burnout? Die meisten bleiben drei, vier Jahre in dem Job. Man hat den Eindruck, dass Ihre Figuren vielfach sehr selbstreflexive Charaktere sind, die zugleich innerhalb und außerhalb ihrer Rolle existieren. Herr Schneyder aus "junk space" etwa erklärt, dass er auf einem "Arschlochtrip" war und es einfach dazu gehörte, Frauen zu entlassen. Der gefällt sich auch darin – Brutalität ist ja etwas, das schick geworden ist. Er ist der, der durchgreift, "den Job" eben erledigt. Das heißt dann "Verantwortung übernehmen". Genau. Wie arbeiten Sie denn mit der Sprache? Mein Gott, ja – da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Texte sind sprachkritisch im klassischen Sinne: Ich gehe von der Sprache als Material aus – als der Sprache, die uns spricht. Etwas überspitzt ausgedrückt: Es geht darum, dass das Subjekt eher ein Effekt von Sprache ist als ein souveräner Sprecher, es geht um die Diskurse, die uns miterzeugen. Was bleibt dann vom Subjekt? Wollen wir es schon wieder verabschieden? Es ist ja keine Verabschiedung von etwas, was mal da war und nun verschwunden wäre. Bloß die Subjektivierungsprozesse sehen heute eben anders aus als noch vor fünfzig Jahren. Außerdem sind wir ja nicht aus einem Guss, sondern haben verschiedene Zeiten in uns. Bei Alexander Kluge kann man lesen, dass die Darmzellen klüger sind, wenn sie verhindern, dass ein Pilot Bomben über dem Irak abwirft, weil er just in dem Moment Durchfall kriegt. Wir müssen mit Ihnen noch über Preise reden. Sie haben den Förderpreis zum Staatspreis für österreichische Literatur bekommen. Das habe ich jedenfalls von einem Freund erfahren, der es in der Zeitung gelesen hat. Als zweite Information habe ich die Reaktionen von Christoph Ransmayr und Peter Huemer im Standard gelesen, die ihr Preisgeld weitergegeben haben. Als ich in Deutschland den BDI-Preis bekommen habe, der ähnlich renommiert ist, bin ich dreimal angerufen worden, weil man sich erkundigen wollte, ob ich den überhaupt annehmen würde. Und in Österreich? Franz Morak hat auf der Buchmesse zur Pressefrau des S. Fischer Verlags nach einem Gespräch gesagt: "Ach, der Röggla geb ich jetzt auch mal einen Preis." Das ist dieses paternalistische Scheißverhalten, das in Österreich offenbar üblich ist. Kurz und gut: Sie wurden bis heute vom Bundeskanzleramt nicht kontaktiert? Nein. Mich hat nur Josef Winkler angerufen und mir gesagt, dass der Preis schon okay ist und dass ich ihn annehmen soll. Und werden Sie nun? Auf alle Fälle. Die Frage ist nur, wie ich mit dem Geld umgehe. Ich finde diese Argumentation "Wer’s nötig hat, soll’s nehmen" schon etwas eigenartig. Das wird zuerst so moralisch aufgeladen, etwa indem Peter Huemer schreibt, der Preis sei ein Gesinnungstest, und dann heißt es: Na ja, die Armutschkerln, die ihn wirklich brauchen, sollen ihn halt nehmen. Und was sagen Sie zum Nobelpreis für Elfriede Jelinek? Ich habe mich gefreut – so wie über einen gelungenen Schmuggel. Super Sache! Ich war gerade auf Sizilien, als mich jemand von der taz anrief und ganz trocken sagte: "Elfriede Jelinek hat den Nobelpreis bekommen." Ich sagte: "Verarsch mich nicht!" Dann wurde ich von der Presse angerufen, die wissen wollte, ob das politische Gründe hätte. Das fand ich gaga. Wir sind ja nicht in Angola. Die Frau hat 35 Jahre lang publiziert! Dabei hatte man schon den Eindruck, dass Jelinek auch im deutschen Feuilleton "durch" ist. Jelineks ästhetische Position wird im Moment nicht gewollt. Literatur soll restaurativen Zwecken dienen. Ein Familienroman, wenn’s geht, nicht unbedingt alt-klassisch, aber dann halt so Jonathan-Franzen-artig. Die Selbstreflexion des Mediums ist weniger gewünscht. Man soll mitleben können, einen Ort haben, wo man sich selber noch spüren kann – bloß keine Abstraktion, die sich dazwischenschiebt. Literatur soll den Umstand kompensieren, dass es kaum noch ein Gegenüber gibt, das sich einem shakespearemäßig entgegenstellt. Man hat doch immer mit Leuten zu tun, die sich entziehen – da sind wir schon wieder bei den Unternehmensberatern. Wie wichtig ist denn Jelinek für Sie als Schriftstellerin? Ich hab die früher verschlungen und finde sie auch sehr wichtig, arbeite aber anders. Nicht dass ich sie deswegen abwerte, aber mein Interesse hat sich verschoben, habe möglicherweise einen Materialbegriff, bin stärker dem Dokumentarischen zugewandt. Elfriede Jelinek würde zum Beispiel nie hergehen und mit den Leuten Gespräche führen. Ich will das aber auch nicht immer wiederholen; in meinem nächsten Projekt gibt es ganz andere Formen von Recherche. Wie sehen Sie sich denn im Umfeld zu Zeitgenossen, die am Theater arbeiten, etwa René Pollesch? Da gibt’s natürlich Berührungspunkte, aber René Pollesch, Frank Castorf oder Christoph Schlingensief – das sind Leute, die dauernd produzieren, ständig was raushauen in einem Rhythmus, der so etwas wie eine Suche nach einer Form nicht mehr ermöglicht. Das hat schon auch was Aggressives, was ich erschreckend finde, auch wenn mir die Geste wiederum gefällt, wenn sie was Punkiges bekommt. Auf der anderen Seite ist angenehm, wenn es dann noch Leute gibt, die mal sagen: Nee, das mach ich jetzt nicht. Die Verweigerung bleibt also schon noch. Na sicher! Auf der individuellen Ebene auf alle Fälle. Kollektiv wird’s halt schwierig. |
Wolfgang Kralicek und Klaus Nüchtern |